Preisgekrönte Siliziumkarbid-Forschung am Fraunhofer IISB
Für ihre am Fraunhofer IISB in Erlangen angefertigte Doktorarbeit über das Versetzungsverhalten bei der Homoepitaxie von Siliziumkarbid – dem idealen Werkstoff für die Leistungselektronik – wurde Frau Dr. Birgit Kallinger bei der Deutschen Kristallzüchtungstagung in Freiberg mit dem Nachwuchspreis 2012 der Deutschen Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung e.V. ausgezeichnet.
Der mit insgesamt 2.500 € dotierte Nachwuchspreis wird von der Deutschen Gesellschaft für Kristallwachstum und Kristallzüchtung e.V. (DGKK) im Rahmen der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung vergeben. Mit dem Preis würdigt die DGKK herausragende wissenschaftliche Leistungen von Nachwuchswissenschaftlern, die auf dem Gebiet der Kristallzüchtung und des Kristallwachstums entstanden sind. Die gemeinnützige DGKK stellt seit etwa 40 Jahren den Berufsverband von Kristallspezialisten dar, die sich mit der Herstellung von Kristallen, genannt „Kristallzüchtung“, und deren künstlich bedingter Größenzunahme, genannt „Kristallwachstum“, beschäftigen. Schätzungen zu Folge stehen in Deutschland mindestens 10.000 Arbeitsplätze in Verbindung mit Kristallzüchtung und -wachstum. Dies umfasst die eigentlichen Kristallherstellungs- und bearbeitungsunternehmen, aber auch Zulieferer für Anlagen und Geräte sowie für Betriebs- und Hilfsstoffe. Die satzungsgemäße Aufgabe der DGKK ist es, Forschung, Lehre und Technologie auf dem Gebiet des Kristallwachstums und der Kristallzüchtung und insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. An der deutschen Kristallzüchtungstagung im März 2011 in Freiberg nahmen rund 200 Experten aus Forschung und Industrie teil.
Siliziumkarbid (SiC) eignet sich aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften hervorragend als Halbleitermaterial für die Leistungselektronik. Auf SiC basierende Schottkydioden werden z.B. bereits seit 2001 erfolgreich in High-end-Netzteilen eingesetzt. Durch Kristalldefekte im Material wurde bei diesen Dioden jedoch die Ausbeute bei der Herstellung beeinträchtigt. Andere – bipolare – Bauelemente konnten in der Vergangenheit nicht kommerzialisiert werden, weil Kristallfehler im Verdacht standen, die Langzeitstabilität zu limitieren.
Für die Bauelementeherstellung muss SiC in einer dünnen kristallinen Schicht auf einem SiC-Substrat mittels Epitaxie abgeschieden werden. Dies erfolgt bei Temperaturen über 1500°C aus gasförmigen Silizium- und Kohlenstoffverbindungen. Um die elektrischen Eigenschaften der SiC-Schicht gezielt einzustellen, wird bei dem Epitaxieprozess Stickstoff oder Aluminium als Dotierstoff zugegeben. Je nach zugegebener Dotierstoff-Menge erreicht man dann einen niedrigen oder hohen elektrischen Widerstand. Die aufgebrachten SiC-Schichten müssen darüber hinaus eine makellose kristalline Struktur aufweisen. Insbesondere Materialdefekte in Form von sogenannten Versetzungen, die in Schrauben- und Stufenversetzungen sowie Basalebenenversetzungen unterschieden werden, sind hierbei kritisch.
Birgit Kallinger hat in ihrer Doktorarbeit am Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB ein grundlegendes physikalisches Verständnis für das Verhalten der Versetzungen bei dem zentralen Prozessschritt der Bauelementherstellung – der Epitaxie – erarbeitet und verschiedene Wege zur Vermeidung der Kristallfehler abgeleitet. Sie konnte insbesondere zeigen, dass die besonders kritischen Defekte, die Basalflächenversetzungen, während der Epitaxie durch geeignete Prozessbedingungen vermieden werden können. Basierend auf dem von ihr neu erarbeiteten Know-how wurden bipolare Testbauelemente hergestellt, an denen eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die verbesserte Prozessierung die Langzeitstabilität von Bipolardioden positiv beeinflusst.
Um die problematische Kristalldefekte in SiC in Form der verschiedenen Versetzungstypen sowie deren Dichte und Verteilung nachzuweisen, setzt die Industrie seit Jahren standardmäßig das Verfahren des defektselektiven Ätzens ein. Bei dieser Methode werden um die Versetzungen herum Ätzgruben erzeugt, die spezifisch für den jeweiligen Versetzungstyp sind. Die Ätzgruben werden anschließend automatisiert unter dem Mikroskop ausgezählt. Birgit Kallinger wies durch systematische Untersuchungen nach, dass die bislang etablierte Methode dieses defektselektiven Ätzens sich unter bestimmten Bedingungen als unsicher erweist. Mit Hilfe einer direkten Nachweismethode – der Synchrotron-Röntgentopographie – bestimmte Birgit Kallinger an der Synchrotron-Strahlenquelle ANKA (Ångströmquelle Karlsruhe) den Versetzungshaushalt in SiC deshalb ganz genau.
„Die Konsequenz aus dem Vergleich der Ergebnisse des defektselektiven Ätzens und der direkten Analyse mittels Röntgentopographie ist, dass erstens mit vielen in der Literatur veröffentlichten Ergebnissen vorsichtig umgegangen werden muss, zweitens zwar das Defektätzen als einfache, billige und schnelle Methode in der industriellen Produktion geeignet ist, um die Anzahl und Verteilung aller Versetzungen zu bestimmen sowie die Basalebenenversetzungen eindeutig zu identifizieren, drittens aber ein neues, einfaches und schnelles Ätzverfahren entwickelt werden muss, um auch eindeutig Stufen- und Schraubenversetzungen für hohe Dotierungen unterscheiden zu können“, so Birgit Kallinger.
Der Nachwuchspreis der DGKK honoriert die wichtigen Beiträge von Birgit Kallinger, die Materialeigenschaften von Siliziumkarbid besser zu verstehen und – aufbauend auf diesen Erkenntnissen – weiter zu verbessern, so dass neue Anwendungsgebiete in der Leistungselektronik erschlossen werden können. Birgit Kallinger führte ihre wissenschaftlichen Untersuchungen im Rahmen des von der Bayerischen Forschungsstiftung geförderten Projekts KoSiC durch.
Ihre Doktorarbeit mit dem Titel „Versetzungsverhalten bei der Homoepitaxie von hexagonalem Siliziumkarbid (4H-SiC)“ ist im Fraunhofer Verlag erschienen (ISBN: 978-3-8396-0342-0).
Last modified:
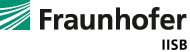 Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology IISB
Fraunhofer Institute for Integrated Systems and Device Technology IISB